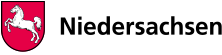Bildrechte: Dr. Maren Feldmann, LAVES
Bildrechte: Dr. Maren Feldmann, LAVES
Q-Fieber
Stand: 21.02.2024
Q-Fieber (Query-Fieber = unklares Fieber) ist eine weltweit verbreitete Infektionskrankheit bei Tieren und beim Menschen, die durch Coxiella burnetii verursacht wird. Dieses Bakterium vermehrt sich nur innerhalb von Körperzellen und existiert in verschiedenen Formen. Die sporenähnliche Dauerform zeichnet sich durch eine sehr hohe Überlebensfähigkeit in der Umwelt aus. Die Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen und physikalischen Einflüssen ist beträchtlich, insbesondere Hitze oder Austrocknung. Coxiellen können z.B. in Staub oder Wolle teilweise jahrelang überleben und werden über verschiedene Vektoren sowie Wind weiterverbreitet.
Alle Haustiere und der Mensch sind empfänglich für Infektionen mit Coxiella burnetii. Schafe, Ziegen und Rinder sind hauptsächlich betroffen. Ein wichtiges Reservoir und Vektor sind Arthropoden, insbesondere Zecken, die über den Zeckenkot Coxiellen ausscheiden.
Q-Fieber ist eine Seuche der Kategorie E, die innerhalb der Union überwacht werden muss. Sowohl beim Tier als auch beim Menschen ist Q-Fieber eine meldepflichtige Erkrankung. Reservoir und Vektor (hauptsächlich Ausscheidung der Coxiellen über den Zeckenkot).
Infektion beim Tier
Die Infektion findet hauptsächlich durch die Inhalation von erregerhaltigen Aerosolen und Stäuben statt. Infizierte Tiere scheiden mit dem Kot und Urin, aber vor allem mit Geburtsflüssigkeiten, enorme Mengen der hochinfektiösen sporenähnlichen Bakterien aus. Die Einschleppung in den Bestand kann durch subklinisch oder asymptomatisch erkrankte bzw. infizierte Tiere sowie andere infizierte Haustiere und Vektoren erfolgen. Das klinische Bild ist bei den Haustieren sehr unterschiedlich ausgeprägt. Bei Rindern können neben einem symptomlosen Verlauf Metritiden und Unfruchtbarkeit, Nachgeburtsverhalten und in seltenen Fällen Aborte auftreten. Schafe erkranken meist symptomlos. Es kann jedoch zu Aborten und der Geburt lebensschwacher Lämmer kommen, die bei Ziegen häufig auftreten.
Differentialdiagnostisch können bei Hauswiederkäuern grundsätzlich Aborte, die Geburt lebensschwacher Lämmer und weitere reproduktionsbezogene Störungen mit Q-Fieber in Verbindung gebracht werden und bedürfen der Abklärung.
Q-Fieber beim Menschen (Zoonose)
Q-Fieber ist eine Zoonose. Das bedeutet, es ist eine vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheit, die durch die Inhalation von erregerhaltigem Material übertragen wird. Menschen mit engem Tierkontakt sind hauptsächlich von Infektionen betroffen (z.B. Landwirte, Schäfer, Tierärzte, Schlachthofmitarbeiter). Einige Risikofaktoren für eine Infektion sind Geburtshilfe bei Wiederkäuern, insbesondere Geburtshilfe bei Schafen, kontaminierte Berufskleidung (z.B. Stallkleidung) sowie die Schafschur. Allerdings können sich weitere Personen infizieren, wenn ein Kontakt zu kontaminierten Gegenständen (z. B. Wolle) oder kontaminierten Weiden und Treibwegen von Wanderschafherden besteht.
In den meisten Fällen verläuft die Erkrankung beim Menschen ohne oder nur mit milden grippeähnlichen Symptomen. In manchen Fällen führt die Infektion zu einem akuten unspezifischen Krankheitsverlauf mit plötzlich auftretendem Fieber, Schüttelfrost, Glieder-, Kopf- und Gelenkschmerzen sowie Lungen- und Herzmuskelentzündungen. In wenigen Fällen wird ein chronischer Verlauf beobachtet, der sich häufig als chronische Herzmuskelentzündung darstellt.
Für Schwangere ist eine Infektion mit Coxiella burnetii besonders gefährlich. Es besteht die Gefahr einer Fehlgeburt oder weiteren Komplikationen für die Schwangerschaft bzw. das Neugeborene.
Präventivmaßnahmen
Für Rinder, Schafe und Ziegen ist ein Impfstoff gegen Coxiella burnetii in Deutschland zugelassen. Ist der Erreger in einem Bestand amtlich nachgewiesen, erstattet die Tierseuchenkasse Niedersachsen eine Beihilfe für die Impfkosten bei der Grundimmunisierung gegen Q-Fieber (s. hier).
Hygienische Maßnahmen bei der Geburtshilfe und die Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Tierbeständen können das Risiko einer Infektion des eigenen Bestandes und die Verbreitung minimieren (s. Infobox).
 Bildrechte: Dr. Maren Feldmann, LAVES
Bildrechte: Dr. Maren Feldmann, LAVES
- Q-Fieber Leitfaden Baden-Württemberg (untersuchungsaemter-bw.de)
- RKI - RKI-Ratgeber - Q-Fieber
- Q-Fieber eine weltweit verbreitete Zoonose (q-gasp.de)
- Empfehlung für die Haltung von Schafen und Ziegen der Deutschen Gesellschaft, Fachgruppe der DVG
- Empfehlung für die Haltung von Schafen und Ziegen der Deutschen Gesellschaft, Fachgruppe der DVG
- Leitfaden Biosicherheit in Rinderhaltungen (tknds.de)
- BMEL - Tiergesundheit - Empfehlungen für Hygienemaßnahmen bei der Haltung von Wiederkäuern
- Beihilfen - Niedersächsische Tierseuchenkasse (ndstsk.de)